1. Das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern: ein Passamahl?
 |
|
| Der
angebliche Abendmahlsaal auf dem Zion in Jerusalem |
1.1. Der Erzählrahmen
Das christliche Abendmahl hat sich höchst wahrscheinlich aus dem
letzten Mahl Jesu mit seinen Jüngern entwickelt. Dieses letzte Mahl
aber war nach Meinung zahlreicher Bibelwissenschaftler ein Passamahl (J.
Jeremias). Ihre Argumente sind im wesentlichen die folgenden:
- Die Datierung der Ereignisse: Nach den synoptischen Evangelien (also
Mt, Mk und Lk) starb Jesus am Vormittag des 15. Tag des jüdischen
Frühjahrmonats Nissan. Das Abendmahl fiele dann genau auf den Vorabend
des Passafestes, an dem Jüdinnen und Juden bis heute im Kreis der
Familie den Sederabend feiern. Johannes nennt abweichend davon den 14.
Nissan als Todesdatum. Doch scheint hier das theologische Interesse des
Evangelisten entscheidend gewesen zu sein, Jesus als „Lamm Gottes“
darzustellen, das wie die Passalämmer bereits am Rüsttag (noch
heute: gr. „paraskewi“=Freitag) sein Leben lassen muss.
- Neben der Zeit spricht auch der Ort des letzten Mahls für ein Passafest:
Das Passa war um die Zeitenwende eines der drei großen Wallfahrtsfeste,
zu denen fromme Juden nach Jerusalem pilgerten. Jesus war einer dieser
vielen tausend Festpilgern, die am Passafest nach Jerusalem kamen, um
dort am Tempel ihr Opfer darzubringen. Zum anschließenden Essen
des Lammes suchte er, wie in der Tora geboten, einen Ort im Stadtbezirk
auf, obwohl er sonst ein Quartier außerhalb (Bethanien) bezogen
hatte.
- Passa feiert man normalerweise im Kreis der eigenen Familie. Jesus feierte
das letzte Mahl im Kreis seiner engsten Jünger, von denen er einmal
sagte: „Siehe da, das ist meine Mutter, und das sind meine Brüder!“
(Mt 12,49). Auch hier also gibt es Berührungspunkte mit der jüdischen
Passatradition.
- In Lk 22,15 sagt Jesus zu seinen Jüngern, bevor das letzte Mahl
mit ihnen feiert: „Mich hat sehnlich verlangt, dieses Passamahl
mit euch zu essen, bevor ich leide“. Ausdrücklicher kann ein
Bezug zwischen Passa und Abendmahl nicht hergestellt werden. Freilich
muss festgehalten werden, dass die anderen Evangelien sich so explizit
nicht äußern. Oft hält man die lukanische Darstellung
des Abendmahls von Paulus abhängig, der in 1 Kor 11 zwar keinen Zusammenhang
zu Passa herstellt, der das Thema dafür aber in 1 Kor 5,7-8 streift.
Im ältesten Evangelium, bei Mk, ist der Zusammenhang zwar weniger
deutlich als bei Lk, aber doch erkennbar: „ Wo willst du, dass wir
hingehen und das Passalamm bereiten, damit du es essen kannst?“
(Mk 14,12).
1.2 Die Einsetzungberichte
Während im Erzählrahmen der synoptischen Evangelien die Bezüge
des letzten Mahles Jesu mit seinen Jüngern zum jüdischen Passafest
also nicht zu leugnen sind, sind die Einzetzungsberichte selbst diesbezüglich
nicht ganz so eindeutig. Schauen wir uns die einzelnen Berührungspunkte
genauer an:
- Vom Jünger, der Jesus verrät, wird in Mk 14,20 gesagt, er
tauche mit Jesus (gleichzeitig) die Hand in die Schüssel. Leider
wird nicht gesagt, was sich in der Schüssel befand. Wer schon einmal
an einem Sedermahl teilgenommen hat, fühlt sich erinnert an die beiden
Schalen, die als eine Art „Dip“ fungieren: Zum einen wird
Petersilie in Salzwasser getaucht, zum anderen aber auch Rettich in einen
Brei aus Äpfeln, Zimt und Nüssen. Könnte der Mk-Bericht
hier an einen dieser Bräuche erinnert haben?
- In den synopt. Evangelien spricht Jesus ein Dankgebet über dem
Brot, bevor er es bricht und an seine Jünger verteilt. Man kann dieses
Gebet mit dem Segensspruch (beracha) über der Mazze in Verbindung
bringen, die die Haupmahlzeit bei Passa eröffnet.
- Ebenso ist von einem Dankgebet vor der Darreichung des Weines die Rede,
der als Segensbecher das Hauptmahl abschließt.
- Schließlich könnte man den Lobgesang erwähnen, mit dem
bei Mt und Mk das letze Mahl endet. Mit ihm dürfte die Rezitation
der Hallelpsalmen (Ps113-114/115-116) gemeint sein, die auch bei einer
Passafeier integraler Bestandteil ist.
2. Andere Gemeinschaftsmähler
Viele der genannten Merkmale des Abendmahls treffen freilich nicht nur für das Passamahl, sondern im Grunde für jede feierliche Mahlzeit zu - und das nicht nur im Judentum, sondern in der antiken Welt überhaupt.
2.1. Heidnische Analogien
So hat die Religionsgeschichtliche Schule im 19./Anf. 20.Jhd. (R. Bultmann
u.a.) v.a. auf Mysterienkulte (Kybele und Attis, Mithras etc.) hingewiesen,
wo ähnlich wie beim Abendmahl eine sterbende und auferstehende Gottheit
von den Kultusteilnehmern durch Essen „einverleibt“ wird („Theophagie“).
Es sei nur am Rande vermerkt, dass jüdische Kritiker des Christentums
sich bei einem solchen Verständnis von Abendmahls an kanibalische
Sitten erinnert fühlten (S. Freud: „Totem und Tabu“ =>
R. Rubenstein). Dieser Ansatz hat heute wesentlich an Überzeugungskraft
eingebüßt, v.a. weil man die Mysterienreligionen heute anders
versteht als noch vor 100 Jahren (vgl. H.J. Klauck). Gemeinschaftsmähler
gab es auch in zahlreichen antiken Vereinen und Philosophenschulen. Einige
dieser Symposien liefern interessantes Vergleichsmaterial zum Studium
des Abendmahls.
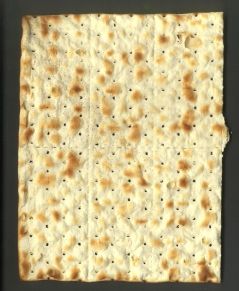 |
|
| Mazzen
- ungesäuertes Brot |
2.2. Jüdische Analogien
Selbst wenn man, wofür vieles spricht, auf den jüdischen Kontext
rekurriert, muss man nicht das Passamahl als Vorlage für das Abendmahl
ansehen. Brot und Wein, sowie die begleitenden Segenssprüche, spielen
bei jedem normalen Sabbatmahl eine Rolle. Häufig wird auch die Nähe
des letzten Abendmahls zu den Gemeinschaftsmählern der Sekte vom
Toten Meer betont (H.G. Kuhn). In der Sektenregel (1QS 6,2-5) heißt
es beispielsweise: „Und gemeinsam sollen sie essen, gemeinsam Lobsprüche
sagen und gemeinsam beraten. (...) Und wenn sie den Tisch richten, um
zu essen, oder den Most zu trinken, soll der Priester seine Hand ausstrecken,
um den Lobspruch zu sagen über dem Erstling des Brotes und des Mostes“.
Neben den bereits bekannten Elemente Brot, Wein und Lobpreis passt v.a.
die eschatologische (= endzeitliche) Ausrichtung dieser Mahlzeiten von
Qumran gut zum urchristlichen Verständnis des Abendmahls. Wie die
Leute vom Toten Meer ihre Zusammenkünfte als zeichenhafte Vorwegnahme
des messianischen Banketts am Ende der Tage verstanden, so weist auch
das sog. „Entsagungsgelübde“ (Mk 14,25) in die Zukunft,
wo Jesus gelobt, nicht mehr vom Wein zu trinken bis zu seiner Wiederkunft
„im Reiche Gottes“ (ähnlich auch Did 9,1-4).
2.3. Zwischenbilanz
Fasst man das bisher Vorgetragene zusammen, kommt man zu dem folgenden
Schluss: Einige Aspekte des Abendmahlsgeschehens wie der communio-Gedanke
(d.h. die Vorstellung einer Gemeinschaft des Menschen mit Gott bzw. der
Kultteilnehmer untereinander im Mahl) lassen sich bereits durch die heidnischen
Parallelen ungezwungen erklären. Andere Momente wie die endzeitliche
Perspektive dieser Mahlzeit oder das Beten von Hallelpsalmen dabei verweisen
bei der Suche nach Erklärungen jedoch eindeutig auf den jüdischen
Kontext. Es bleibt auch bei Berücksichtigung der zuweilen vorgetragenen
Kritik an dieser These eine genügend große Zahl von Berührungspunkten
speziell zur Passamahl-Tradition, dass ich daran festhalten möchte:
Das Abendmahl ist eine Wiederholung des letzten Mahls Jesu mit seinen
Jüngern, das mit hoher historischer Wahrscheinlichkeit ein Passamahl
war.
Diese These ist nicht neu. Sie wurde in der Vergangenheit oft vorgetragen, um zu belegen, dass in Blut und Leib Christi der alte Bund Gottes mit Israel abgelöst sei zugunsten eines Neuen Bundes, wie ihn der Prophet Jeremia bereits angekündigt hatte (Jer 31,31-34). Doch diese gängige Interpretation erweist sich bei genauem Hinsehen als problematisch: Erstens sprechen nur Paulus und Lk von einem „neuen“ Bund, bei Mk und Mt fehlt das Adjektiv „neu“. Zweitens wird nach der (vermutlich ältesten) Version der Einsetzungsworte (1 Kor 11/Lk) nicht das Blut Jesu, sondern der Kelch als Zeichen des Bundes apostrophiert. Dieses Detail ist für unser Gespräch mit Jüdinnen und Juden von außerordentlicher Bedeutung, für die der Genuss von Blut eine unmögliche Vorstellung ist (Speisegebote!). Drittens aber suggeriert diese Typologie von alt und neu einen historischen Zusammenhang, der in dieser Form nicht gegeben war. Es ist keineswegs so, dass das christliche Abendmahl einlinig aus dem jüdischen Passamahl abzuleiten wäre. Es gibt zwar Bezüge zwischen beiden, die Beeinflussungen dürften aber, wie wir noch sehen werden, gegenseitig gewesen sein.
3. Seder und Abendmahl als parallele Neuschöpfungen
3.1 Bewältigung von Verlusterfahrungen
Die Ordnung eines Sederabends, wie er heute in einem jüdischen Haushalt
gefeiert wird, geht im wesentlichen auf die Mischna zurück. Diese
Sammlung schriftgelehrter Diskussionen lag aber nicht vor dem Anfang des
3. Jhds. in ihrer heutige Fassung vor. Gerade die Materialien, die sich
dem Passafest widmen, werden größtenteils Rabbinen zugeschrieben,
die im 2. Jhd.n.Chr. lebten. Es wäre deshalb ein Anachronismus, die
Abendmahlspraxis der Urgemeinde aus dieser Ordnung ableiten zu wollen.
Manche jüdischen Bräuche sind gar erst im Mittelalter hinzugekommen.
So findet sich etwa bei Maimonides im 13. Jhd. noch nicht der heute allgemein
übliche Lammknochen auf dem Sederteller (Hilton, 53). Wir tendieren
gerne zu einer solchen einlinigen Erklärung, weil wir es gewöhnt
sind, das Judentum als die Mutterreligion anzusehen, aus dem heraus sich
das Christentum entwickelt hat. Doch in Wahrheit sind beide, Judentum
und Christentum, Geschwister – Kinder einer Religion, die spätestens
in der zweiten Hälfte des 1. Jhd. n. Chr. aufhörte zu existieren
(„second temple judaism“).
Der entscheidende Bruch war aus jüdischer Sicht die Zerstörung des zweiten Jerusalemer Tempels und damit das Ende des Opferkultes, der Jahrhunderte lang im Zentrum dieser Religion gestanden hatte. Freilich gab es schon seit Jahrhunderten ein Judentum in der Diaspora (= Zerstreuung), wo man Gott auch ohne Tieropfer dienen konnte. Dennoch bedeutete die Zerstörung des Tempels ein ungeheuerer Verlust, auf den die Rabbinen mit einer Neuinterpretation der Tradition reagierten. Die Christen hatten eine ähnliche Verlusterfahrung zu bewältigen, als irgendwann um das Jahr 30 ihr Hoffnungsträger Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde, den sie für den Messias hielten, mit dem das Reich Gottes anbrechen würde. Die Bewältigungsstrategien bei Christen und Juden waren erschieden, die zugrundeliegenden Mechanismen aber doch ähnlich.
3.2 Abendmahl und Seder
| Buchtipp |
|
Während die Rabbinen versuchten, möglichst viele Elemente des Tempelgottesdienst in die häusliche Liturgie des Sederabends hinüberzuretten, indem sie sie symbolisch verstanden, deuteten die Christen das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern neu im Lichte der gemachten Erfahrungen mit ihrem Herrn. Wie die symbolischen Speisen auf dem Sederteller die Hoffnung der Juden auf Befreiung vom Joch der Fremdherrschaft (konkret: der Römer) wach hielten, so erinnerten Brot und Wein an die rettende Hingabe Jesu für seine Jünger. Nicht die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens stand im Mittelpunkt ihres Verständnisses, sondern die Erlösung aus dieser Welt überhaupt. Das Abendmahl wurde dadurch zu etwas, was es im Judentum überhaupt nicht gibt: einem Sakrament (=Heilsmittel). Während die Rabbinen den Verlust des Tempels dadurch zu kompensieren versuchten, dass sie die eigenen vier Wände zum Heiligtum machten, trösteten sich die Christen über den Tod Jesu damit hinweg, dass etwas von ihm blieb. Es waren nicht nur seine Worte, die den Tod überdauerten, sondern etwas viel konkreteres, etwas, das man sehen, riechen und schmecken kann: Brot und Wein. Zwei Bestandteile des Passamahls, die eine relativ untergeordnete Rolle spielten und deshalb inhaltlich leicht neu zu besetzen waren.
Die ersten Christen griffen also beim Abendmahl Elemente aus der Passatradition
auf, allerdings nicht in der Form des Passa, in der es heute bei Jüdinnen
und Juden gefeiert wird, sondern in der Gestalt, in der es gefeiert wurde,
als der Tempel noch stand. Leider wissen wir über das Passafest zur
Zeit Jesu relativ wenig. So wenig, dass jüdische Historiker zuweilen
auch neutestamentliche Texte mit heranziehen, um diese Lücke zu schließen.
Indem sie rekonstruieren, wie die Frömmigkeitspraxis der ersten Christen
aussah, erfahren sie etwas über die Geschichte ihre eigene Religion
– so wie sie war vor der Transformation, von der vorhin die Rede
war, also vor der Zerstörung des Tempels.
Christen und Juden interpretierten das gemeinsame Glaubenserbe neu, jeweils
im Lichte der eigenen Verlusterfahrungen. Dabei wurden die Christen nicht
nur vom Judentum beeinflusst – diese Einsicht ist mittlerweile Allgemeingut
-, sondern auch umgekehrt das Judentum von den Christen. Das zeigt sich
z.B. daran, dass die Bedeutung des Lammes, das im Christentum so zentral
wurde („Christus als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt
trägt“) im Judentum nach und nach zurückgedrängt
wurde. Während es in der Antike (auch nach der Tempelzerstörung)
offenbar noch gegessen werden dürfte, wenn auch anders zubereitet
als im Tempel, erinnerte später nur mehr ein Knochen an diesen Brauch.
Außerdem scheint man in bewusster Konkurrenz zur christlichen Aufwertung
von Brot und Wein im Judentum drei andere Aspekte des Seder betont zu
haben (pessach, mazza und maror; vgl. mPes X,5), die zur Zeit des Tempels
ebenfalls eine untergeordnete Bedeutung hattten.
Es war auf beiden Seiten häufig eine Beeinflussung in Form von Negation und Abgrenzung, manchmal sogar der Selbstzensur. Was lange Zeit als völlig unanstößig galt, wurde plötzlich aus der eigenen Tradition eliminiert – nur weil die jeweils andere Seite es praktizierte. Das ließe sich auch an anderen Bräuchen zeigen, nicht nur am Themenkomplex „Passa und Abendmahl“.
Lit.: G. Theißen/A. Merz: Der hist. Jesus: §13: Jesus als
Kultstifter
J. Roloff: Das Neue Testament: § 15 Das Abendmahl
| Die Liturgie des Sedermahls nach der Haggada | Evt. Anklänge in den Evangelien |
| A. Vorspeise | |
1. Erster Becher („Kiddusch“), gesegnet vom Hausvater |
Dankgebet über dem Wein (?) |
2. Vorspeise (Grünkräuter, Bitterkräuter, Fruchtmus) |
„..mit mir die Hand in die Schüssel taucht“ (Mk 14,20) |
| B. Passaliturgie | |
1. Passahaggada (=Festlegende), veranlasst durch 4 Fragen des Sohnes |
|
| 2. Passahallel I (Ps 113-114) | Lobgesang (Mt 26,30) |
| 3. Zweiter Becher (Haggadabecher) |
|
| C. Hauptmahl | |
| 1. Tischgebet (mit Mazzen) | Dankgebet über dem Brot |
| 2. Mahl (Lamm, Mazzen, Bittterkräuter, Fruchtmus, Wein) | „..mit mir die Hand in die Schüssel taucht“ (Mk 14,20) |
| 3. Dritter Becher (Segensbecher) | Dankgebet über dem Wein (?) |
| D. Abschluss | |
| 1. Passahallel II (Ps 115-116) | Lobgesang (Mt 26,30) |
| 2. Vierter Becher (Hallelbecher, mit Lobspruch) |
Weiterführende Links
![]() Das
Passafest
Das
Passafest
![]() Wer
war schuld am Tod Jesu?
Wer
war schuld am Tod Jesu?
![]() Gott
zum Greifen nah: Brot als religiöses Symbol
Gott
zum Greifen nah: Brot als religiöses Symbol
![]() Keine
christlichen Sederfeiern! Stellungnahme des Koordinierungsrates der GCJZ
Keine
christlichen Sederfeiern! Stellungnahme des Koordinierungsrates der GCJZ
