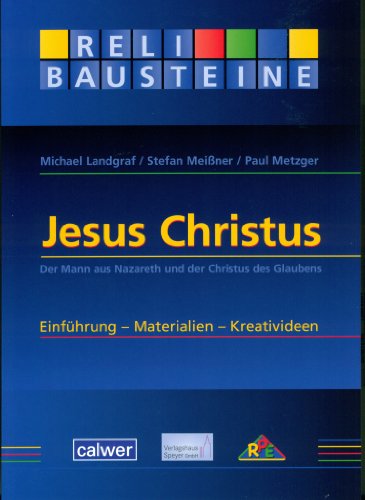„Daß Jesus Christus ein geborener Jude sei...“
von Dr. Stefan Meißner

„Daß Jesus Christus ein geborener Jude sei“ (M. Luther, 1523) , wurde außer in der NS-Zeit in der Kirche nur selten ausdrücklich bestritten. Aber ebenso selten wurde damit theologisch wirklich ernst gemacht. Für ein zur Weltreligion gewordenes Christentum war die Herkunft Jesu zumeist eine zufällige Geschichtstatsache, die für den eigenen Glauben ohne großen Belang ist. Erst in den letzten Jahrzehnten wächst die Einsicht, daß das Leben Jesu nur vor dem Hintergrund des palästinischen Judentums des 1. Jahrhunderts richtig verstanden werden kann.
Wo er herkam
Jesus war Jude hinsichtlich seiner Abstammung. Das setzen die Stammbäume
Jesu in den Evangelien übereinstimmend voraus, wenn sie sich auch
in Details widersprechen mögen. Jüdisch war auch das soziale
Umfeld, in dem er aufwuchs: Glaubt man den meisten Neutestamentlern, dann
ist Jesus nicht in Betlehem (wie das Lk-Evangelium unterstellt) sondern
in Nazareth geboren. Jedenfalls wuchs er in dieser galiläischen Kleinstadt
auf als Jude unter Juden. Wie es die Tora vorschreibt, ließen ihn
seine Eltern bis zum achten Tag beschneiden. Nach Ablauf von 40 Tagen
brachten sie ihn dann nach Jerusalem zum Tempel. Als Erstgeborener seiner
Mutter Miriam mußte er nämlich erst gegen ein Opfer ausgelöst
werden. Zu diesem Bild des jungen Jesus paßt, daß er als Zwölfjähriger
mit jüdischen Toragelehrten diskutiert haben soll. Auch wenn er kaum
eine höhere theologische Ausbildung genossen haben dürfte, waren
seine Bindungen zur Synagogengemeinde seiner Heimatstadt offenbar eng
genug, daß er als Ausleger des profetischen Wochenabschnitts (Haftara)
aufge-rufen werden konnte.
Was er tat
Als Wanderprediger weiß er sich nach eigener Aussage „nur
zu den verlorenen Schafen Israels gesandt“ (Mt 15,24). Als er den
Zwölferkreises ins Leben rief, schuf er damit eine symbolische Repräsentanz
des Zwölf-Stämme-Volkes Israel, um dessen Erneuerung es ihm
angesichts der nahe geglaubten Gottesherrschaft ging. Daß er an
hohen Feiertagen des öfteren nach Jerusalem zum Tempel pilgerte,
zeigt seine Achtung für diese wichtige religiöse Institution
des damaligen Judentums. Sein Aufsehen erregendes Auftreten im Tempel
kurz vor seinem Tode, ist nicht als Angriff auf den Opferkult als solchen
zu verstehen, sondern als zeichenhafte Ansage des neuen, endzeitlichen
Tempels, den sich viele Juden seiner Zeit herbeisehnten. Wahrscheinlich
hintertrieb die Priesteraristokratie danach seine Beseitigung, schon weil
sie gegenüber den Römern für Ruhe und Ordnung verantwortlich
waren. Deshalb von einer Schuld „der“ Juden am Tod Jesu zu
sprechen, wäre jedoch mehr als unangemessen.
Was er glaubte
Zentrale Glaubens- und Lebensinhalte Jesu sind gut jüdisch: Seine
Bibel war die Heilige Schrift der Juden, unser Altes Testament. Die Geltung
ihrer Weisungen (Tora) stellte er nie grundsätzlich in Frage, wenngleich
er sie im Lichte seiner Endzeiterwartung neu akzentuierte. Wenn er davon
öffentlich oder im Kreise seiner Jünger sprach, konnte das kontroverse
Diskussionen hervorrufen. Aber das Judentum seiner Zeit war von einer
unerschöpflichen Vielfalt. Da fielen die Thesen des Rabbis („Lehrer“;
Luther: „Meister“) aus Nazareth kaum aus dem Rahmen des Üblichen.
Viele Streitgespräche mit den Pharisäern wurden ihm von den
Evangelisten erst nach seinem Tod in den Mund gelegt. Er selbst war stets
mit ihnen einig, daß die Tora je und je neu durchbuchstabiert werden
mußte („mündliche Tora“). Wie sie vertrat er auch
die Vorstellung von einer allgemeinen Totenauferstehung am Ende der Tage,
anders übrigens als die konservativeren Sadduzäer.
Wie viele Juden damals und heute betete Jesus dreimal täglich das Schema Jisrael („Höre Israel“), das auf die ausschließliche Verehrung des einen Gottes Israels abhebt. Auch das Vaterunser ist ein durch und durch jüdisches Gebet, wie schon ein Vergleich mit dem Schemone Esre (Achzehn-Bitten-Gebet) zeigt. Als er mit den Worten eines hebräischen Psalmes am Kreuz verschied, hinterließ er eine Anhängerschar, die trotz seines schmachvollen Endes an dem Glauben festhielten, daß in der Person Jesu Gott den Menschen in einer Weise nahe gekommen war, die ihn über andere charismatische Persönlichkeiten hinaus hob. Hier, am Kreuz, endet die Biografie des Juden Jesus von Nazareth. Hier beginnt zugleich die lange Geschichte des Streites zwischen Juden und Christen um seine Bedeutung.
Jesus aus jüdischer Sicht
Die ältere jüdische Literatur (der Talmud und die Toledot Jeschu)
steht so unter dem Eindruck einer sich rücksichtslos durchsetzenden
Heidenkirche, daß sie alles Jüdische an Jesus in Abrede stellt.
Psychologisch verständlich: Die aufgestaute Wut gegen die christlichen
Unterdrücker entlädt sich in der Verunglimpfung ihres Heilands.
Man geht dabei so weit, ihn zum unehelichen Sohn eines römischen
Legionärs Names Pantera zu erklären. Ironie des Schicksals:
Als die Nazis später Jesus zu arisieren versuchten, konnten sie auf
diese jüdische Legende zurückgreifen.
Das jüdische Jesusbild der Neuzeit weicht von dem früheren Zerrbild erheblich ab: Mehr und mehr erkannte (und erkennt) man in dem Mann aus Nazareth den jüdischen Bruder (Martin Buber), der die Gesetze der väterlichen Religion treu bewahrte. Der Tod Jesu am Kreuz konnte gerade in Verfolgungszeiten zur symbolischen Verdichtung des eigenen, jüdischen Martyriums werden. Die positive Würdigung Jesu steht freilich im Kontrast zur schroffen Ablehnung dessen, was die Kirche später aus ihm gemacht hat. So zwingt uns das Gespräch mit Juden dazu, Rechenschaft über unsere eigene Tradition abzulegen: Stellen christliche Lehraussagen über die Person Jesu nur legendarische Übermalungen dar, die das „Original“ immer mehr verdunkeln, oder entspringen sie dem legitimen Wunsch, ihre Bedeutung für die eigene Gegenwart je neu zu auszusagen?
„Bist du es, der da kommen soll?“
Die Wirkung, die Jesus auf seine Mitmenschen hinterließ, muß
gewaltig gewesen sein. Ein Wort oder eine Geste von ihm genügte,
um sie wieder gesund zu machen, ihnen ihren Lebensmut zurück zu geben.
Kein Wunder, daß viele in ihm einen Hoffnungsträger, manche
sogar einen Boten Gottes sahen. Man suchte nach Vergleichen aus der Vergangenheit
und fand sie in der Hebräischen Bibel.
Manche Leute verglichen Jesus mit den Profeten des Alten Bundes, einige von ihnen hielten ihn für den wiedergekommenen Elia, den Wegbereiter des Messias. Der ein oder andere Jünger mag in Jesus sogar selbst den Messias gesehen haben, was diesem aber nicht gerade angenehm war. Wahrscheinlich waren ihm die politisch-nationalen Untertöne, die bei diesem Hoheitstitel mit schwangen, unsympathisch. Mit den antirömischen Unruhestiftern, die in jener Zeit aufgetreten waren, um das Königtum Davids zu erneuern, wollte er nichts zu tun haben. „Mein Reich“, so betonte er, „ist nicht von dieser Welt“.
Wenngleich er bei allem, was er tat und sagte, durchblicken ließ, daß hier Gott selbst am Werk war, war er doch auf der anderen Seite stets darauf bedacht, daß durch die Beziehung der Menschen zu ihm die Einzigkeit Gottes nicht geschmälert wurde. Vielleicht war das auch der Grund, warum er gegenüber Hoheitstiteln generell zurückhaltend war. Sie konnten leicht Hoffnungen wecken, die nicht einzulösen waren. So blieb die Frage, wer Jesus denn eigentlich war, bis zu seinem Tod in der Schwebe.
Sprachgewinn aus dem Rückblick
Oft wird das Wesentliche ja erst aus dem Rückblick deutlich. So war
das wohl auch bei Jesus. Sein schmachvolles Ende am Kreuz warf bei seinen
Anhängern erneut Fragen auf: „Wer war dieser Mensch?“,
und vor allem: „Was bleibt von seinem Leben?“ „Ist mit
seinem Tod nun alles aus, oder geht die "Sache Jesu" weiter
– irgendwie?“
Auch hier halfen jüdische Denkkategorien, das Geschehene zu verarbeiten und zu verstehen: Als einige seiner früheren Jünger von Erscheinungen Jesu berichteten, sprach man von bald von Auferstehung. Daß so etwas grundsätzlich möglich war, hätten die meisten Juden damals bejaht. Daß es allerdings ein gekreuzigter Galiläer sein sollte, der nun „zur Rechten Gottes“ saß, das konnten sich nur wenige vorstellen. Konnte einer, der so endete, wirklich Gottes Bote sein?
Es war wiederum das jüdische Glaubenserbe, das die ersten Christinnen und Christen lehrte, gerade im vermeintlichen Scheitern ein Zeichen von Erwählung zu sehen. Hatte Gott nicht schon immer eine Vorliebe für das Niedrige und Verachtete? Wie sonst erklärte sich die Erwählung Israels, eines kleinen, unbedeutenden Volkes? Und wenn Jesus wirklich ein Profet war – lag da ein gewaltsames Geschick nicht nahe? Dieser Tod Jesu, so folgerte man gut jüdisch, war kein Unfall der Geschichte, sondern eine Heilstat Gottes: Das unschuldige Leiden des Gerechten hat sühnende Kraft. Sein Gehorsam wird denen angerechnet, die seinem Vorbild nachfolgen.
Unpräziser Monotheismus?
Die Sorge Jesu um die Einzigkeit Gottes scheint seine Jünger nicht
lange davon abgehalten zu haben, ihn auf eine Stufe mit Gott zu stellen.
Schon früh erhält Jesus den Hoheitstitel „Herr“
(kyrios), mit dem in der griechischen Bibelübersetzung (Septuaginta)
der alttestamentliche Gottesname "Jahwe" wiedergegeben wird.
Mehr noch: Es gibt sogar Hinweise, daß man Jesus (möglicherweise
schon zu seinen Lebzeiten) kultisch verehrt hat. Sich vor ihm niederzuwerfen
und ihn anzubeten wie einen Gott – geht das nicht zu weit? Ist das
noch vereinbar mit dem jüdischen Bekenntnis zu dem einen Gott Israels?
In der Tat melden viele Juden hier Bedenken an. Sie beklagen, daß
sich das Christentum durch seine zunehmende Verbreitung unter der nichtjüdischen
Bevölkerung des Römischen Reiches von seinen jüdischen
Wurzeln entfernt habe. Die Anpassung an das hellenistische Denken habe
zu einer fortschreitenden Vergottung der Person Jesu geführt. Doch
hat es einen solchen „Sündenfall“, der meist dem Apostel
Paulus angelastet wird, wirklich gegeben?
Die neuere neutestamentliche Forschung hat herausgefunden, daß es schon im palästinischen Judenchristentum (also nicht erst in den paulinischen Gemeinden) eine sehr „hohe“ Christologie gab, die Jesus in unmittelbare Nähe zu Gotte gerückt und auch vor seiner Anbetung nicht Halt gemacht zu haben scheint. Betrachtet man die Vielfalt jüdischen Denkens um die Zeitenwende, wird man der Jesusbewegung ihre jüdische Identität nur schwer absprechen können. Wie die Quellen zeigen, waren diese Leute nicht die einigen Juden, die durch die Einführung von Mittlergestalten (Engel, erhöhte Erzväter od. Profeten) eine Brücke zwischen der Welt und Gott schlagen wollten. Diese Zwischenwesen fungierten nicht selten als verlängerter Arm Gottes, um seinen Machtanspruch auf Erden durchzusetzen, oder als Fürbitter der Gläubigen vor Gott. Ohne Zweifel war das frühe Judenchristentum Teil einer breiteren innerjüdischen Tendenz, die Einzigkeit Gottes zu relativieren. So unangefochten, wie es heute den Anschein hat, war der Monotheismus zur Zeit Jesu jedenfalls nicht.
Konsequenzen für den Dialog
Nimmt man diese Erkenntnisse ernst, wird man nicht mehr ohne weiteres
einen jüdischen Jesus der Historie gegen einen (angeblich unjüdischen)
Christus des Glaubens ausspielen können. Selbst die „hohe“
Christologie des Paulus und des Johannesevangeliums sind jüdischer
als es heute aus dem Rückblick den Anschein hat.
Damit ist die Frage an unsere jüdischen Gesprächspartner neu gestellt: Ist das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu als legitime Fortsetzung des Heilshandelns Gottes denkbar, wie es in der Hebräischen Bibel dokumentiert ist? Umgekehrt werden wir Christen uns fragen müssen, ob es neben der Person Jesu nicht noch andere, ebenfalls legitime Fortsetzungen dieses Heilshandelns geben kann. Nur wo beides ernsthaft in Erwägung gezogen wird, findet heute ein Dialog statt, der diese Bezeichnung wirklich verdient.
Aufsatz aus dem Pfälzischen Pfarrerblatt, Sept. 2002
|
|
Unsere Buchempfehlung zum Thema:
Verlag: Calwer Verlag
erschienen 2012
€ 19,95