Ein Fest für alle Konfessionen:
Die Synagogeneinweihung in Dahn vor 150 Jahren
von Ottmar Weber
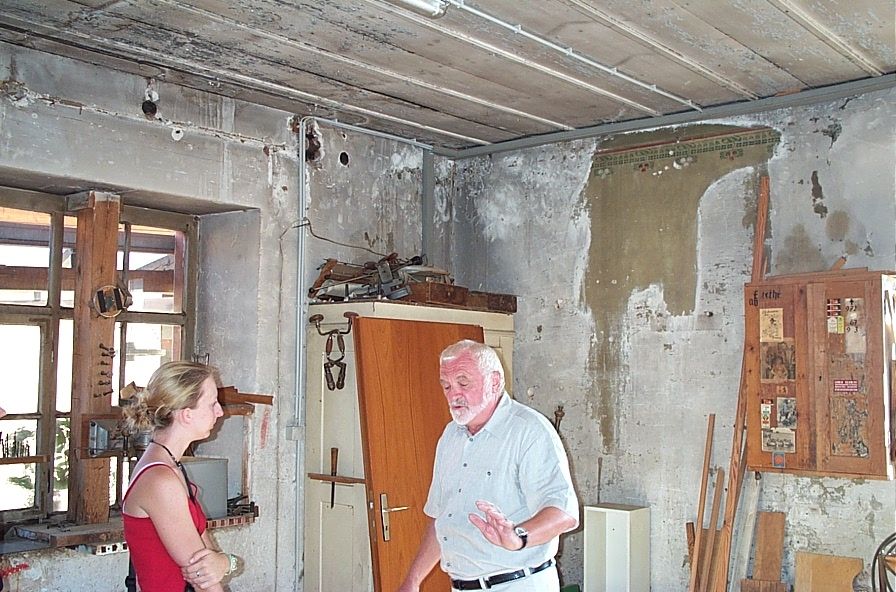
Ottmar Weber bei einer Führung durch die Synagoge
in Dahn
Damals war es ein Fest für alle Einwohner, egal ob Juden oder Katholiken. Als die Dahner Synagoge vor 150 Jahren eingeweiht wurde, feierte der gesamte Ort mit. Ganz anders in den 1930er Jahren, als der NS-Mob das Gotteshaus anzünden wollte. Dass es erhalten blieb, ist einer Dahner Familie zu verdanken. In dieser Woche wird das Jubiläum gefeiert.
Über die Einweihung der Dahner Synagoge am 4. Juli 1873 wusste der Kantonsanzeiger Erstaunliches zu berichten: Glaubensgenossen aus nah und fern waren gekommen, alle Häuser des Dorfes waren beflaggt, von den Bergen donnerten Böller, der Männergesangverein und eine Kapelle begleiteten den nicht enden wollenden Festzug zur neu erbauten Synagoge. Es war ein herrliches Fest im Geiste der Duldung und Nächstenliebe. Religiöse wie konfessionelle Unterschiede schwanden und das Band der Bruderliebe umschlang alle gleich einer großen Familie. Es war bereits die dritte Synagoge, die vor 150 Jahren in Dahn eingeweiht wurde. Die erste 1813 amtlich erwähnte Synagoge befand sich in einem Privathaus, nach mündlicher Überlieferung im Haus Kirchgasse 5. Die zweite Synagoge wurde 1822 in der Schäfergasse 8 (Judengasse) errichtet. 1872/1873 wurde sie wegen Baufälligkeit abgerissen und an gleicher Stelle die dritte Synagoge errichtet. Direkt daneben war schon 1843 die israelitische Schule mit Mikwe fertig gestellt worden. Synagoge und Schulhaus sind in ihrer Substanz noch gut erhalten. Von der ersten Synagoge gibt es weder Abbildungen noch sind Reste der zweiten Synagoge zu finden.
Das Gebäude
Der schlichte Bau ist aus Bruchsteinen gemauert, seine Mauern sind
60 Zentimeter stark. Das nicht unterkellerte Gebäude, auf einem Sockel
aus Sandstein errichtet, bot etwa 60 Männern und auf der Empore etwa
30 Frauen Platz. Den Außenbau gliederten an den Längsseiten
je drei hohe, rundbogige Fenster, mit leicht hufeisenförmiger Bekrönung
in maurisch-orientalischem Stil. Auf der Nordseite ist ein Fenster noch
in seiner ursprünglichen Form erhalten. Die übrigen wurden 1938/1939
beim Umbau der Synagoge in eine Schreinerei durch das Einziehen waagerechter
Fensterstürze zu Fabrikfenstern verbreitert. Bei dem Umbau ist auch
ein chorähnlicher Anbau, vergleichbar einer Apsis, an der Ostseite
entfernt worden. In beiden Giebelspitzen finden sich Rundfenster im Originalzustand.
Den Giebelabschluss auf der Westseite bildeten die Zehn-Gebote-Tafeln,
die beim Umbau ebenfalls entfernt wurden. Im Westen befindet sich auch
der Eingang. Über drei oder vier Sandsteinstufen führte ein
überdachter Zugang. Das Portal aus rotem Sandstein ist gut erhalten.
Eingangstüren tragen noch die ursprüngliche lind- und dunkelgrüne
Farbe. Außen ist auf der Nordseite der glatte Kalkputz mit ockergelbem
Anstrich teilweise noch zu sehen. Auf dieser Seite wurde 1929 ein Kamin
errichtet.
 |
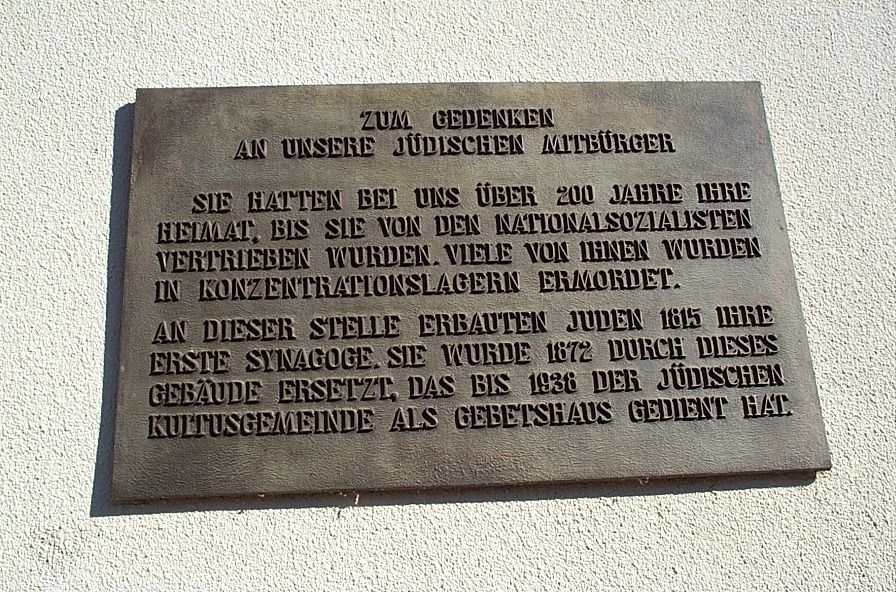 |
 |
Getrennte Bereiche für Männer
und Frauen
Männer und Frauen betraten getrennt die Synagoge. Die Frauen
kamen durch die linke Portaltüre in einen Windfang aus Holz, der
den Blick in die Männersynagoge verwehrte. Von hier aus gelangten
sie über eine Holzstiege auf die Frauenempore. Die Empore aus Holz
verläuft an der Nord-, West- und Südwand, getragen von vier
gusseisernen Säulen der Firma Gienanth. Die Balustrade der Empore
diente den Frauen als Gebetpult. Beim Umbau wurde sie entfernt und in
die Aussparung eine Holzdecke eingezogen. Die Männer traten durch
die rechte Türe in die Synagoge. Links und rechts des Mittelgangs
standen die Pulte auf einem leicht erhöhten Holzboden, rechts in
acht, links in sieben Reihen. Der Toraschrein in der Apsis bestimmte die
Gebetsrichtung nach Osten. Er war von zwei aufgemalten Säulen flankiert.
Darüber hingen die Zehn-Gebote-Tafeln. Ein Vorhang aus Brokat, Samt
oder Seide verhüllte ihn. Vor dem Toraschrank hing an einer Kette
das Ewige Licht, links und rechts jeweils ein Leuchter. Im Mittelgang
stand das Vorlesepult, von dem Kantor oder Vorbeter im Gottesdienst Gebete
und Gesänge vortrug. Diese Aufgabe fiel bis zum Ersten Weltkrieg
Lehrer Nathan Haas und danach bis 1933 Lehrer Ludwig Nußbaum zu.
Nach dessen Wegzug 1933 nach Frankfurt hat Julius Katz das Amt des Vorbeters
bis zu seinem Tode 1938 übernommen. Bilder und Statuen gab es gemäß
dem Zweiten Gebot in der Synagoge nicht.
Das Ende der Synagoge
Das Ende der Dahner Synagoge begann 1935/1936, als das Minjan, die für
den Synagogengottesdienst geforderte Mindestzahl von zehn erwachsenen
männlichen Juden, nicht mehr erbracht werden konnte. Außerdem
wurden die Gottesdienste regelmäßig durch nationalsozialistische
Provokateure gestört. Ein ordentlicher Gottesdienst war nicht mehr
möglich. Am 18. August 1938 kauften schließlich die Eheleute
Ludwig und Anna Flory von Josef Katz, Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde
Dahn, die Synagoge mit dem jüdischem Schulhaus. Ludwig Flory versah
unverzüglich das jüdische Schulhaus zur Hofseite hin mit einem
Anbau (Treppenhaus) und baute die Synagoge in eine Schreinerwerkstatt
um. Alle Rundbogenfenster, bis auf eines auf der Nordseite, wurden durch
breite Industriefenster ersetzt. Am Ostgiebel wurde die Apsis entfernt
und ein Fenster eingesetzt. Im Innern der Synagoge nahm Flory nur die
nötigsten Veränderungen vor. Als der Mob in der Reichspogromnacht
bei der Synagoge auftauchte, um sie anzuzünden, scheuchte sie Ludwig
Flory davon. Die Übernahme und der insgesamt schlichte Umbau durch
Anna und Ludwig Flory haben das Kulturdenkmal vor der Zerstörung
bewahrt.
Innenausmalung noch erhalten
Die Inneneinrichtung und liturgischen Geräte der Dahner Synagoge
gingen vollständig verloren. Die Synagogenausmalung ist durch einen
Überstrich mit Kalkfarbe wirkungsvoll konserviert. Bei der Ausmalung
handelt sich um eine dekorative, am Jugendstil orientierte Schablonenmalerei
mit Rankenmustern und ?oralen Motiven. Die Farben im Innenraum leuchten
in Grün- und Brauntönen auf ockergelbem Untergrund, der Sockel
ist dunkelgrün und durch ein karminrotes Band abgesetzt. Die Kalkkaseinfarbe
ist von guter Deckfähigkeit mit leichtem Glanz und wasserfest; der
spätere Kalkanstrich kann mit einem weichen feuchten Schwamm problemlos
entfernt werden. Durch den Kalkanstrich wurde auch die Ausmalung der Holzdecke
in der Frauensynagoge konserviert. Von einem taubenblauen Himmel heben
sich Sterne in goldener Farbe und verschiedener Größe gut sichtbar
ab.
Erhaltenswerte Kulturdenkmale im
Wasgau
Mit der Dahner Synagoge, dem jüdischen Friedhof bei Busenberg sowie
drei Schulhäusern und einer Mikwe besitzt der Wasgau einzigartige
Zeugnisse jüdischen Lebens. Es sind Denkmale einer gemeinsamen Kultur
und mahnende Erinnerungen an die Geschichte, die erhalten werden sollten.
Mit der Bereitschaft der Stadt Dahn, die Synagoge zu kaufen und mit finanzieller
Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz umzugestalten, ist dafür
ein wichtiger Schritt getan worden. Der neu gegründete Dahner Förderverein
„Landjudentum im Wasgau“ hat in seiner Satzung verankert,
die Organisation der Dahner Synagoge als Ort der Begegnung, des Erinnerns
und Gedenkens zu übernehmen. Damit sind gute Voraussetzungen für
das Gelingen des Projekts Dahner Synagoge und Landjudentum im Wasgau gegeben.
Quelle: DIE RHEINPFALZ, Artikel vom 03. Juli 2023
Weiterführender Link
![]() Auf
den Spuren der Juden in der Südpfalz
Auf
den Spuren der Juden in der Südpfalz